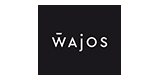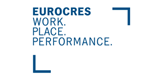Audiologo-Experte Hirt: "Automatische Musik im Netz kann Konsumenten stressen"
Ozeanrauschen für HolidayCheck.de, Klaviertöne für Activia - die Agentur Audity aus Konstanz entwickelt Audiologos für Marken. Im Interview mit W&V Online erklärt Rainer Hirt, Mitbegründer der Agentur, wie sich durch Audiologos der monetäre Markenwert steigern lässt und welchen Einfluss Musik auf Kaufentscheidungen hat.
Ozeanrauschen für HolidayCheck.de, Klaviertöne für Activia - die Agentur Audity aus Konstanz entwickelt Audiologos für Marken. Im Interview mit W&V Online erklärt Rainer Hirt, Mitbegründer der Agentur, wie sich durch Audiologos der monetäre Markenwert steigern lässt und welchen Einfluss Musik auf Kaufentscheidungen hat.
Herr Hirt, warum sollte eine Marke ein Audiologo haben und was muss bei der Kreation beachtet werden?
Ein Audiologo, als Teil eines strategischen Audio-Branding-Konzeptes, differenziert eine Marke von ihrem Wettbewerb, macht aus ihr ein multisensorisches Erlebnis und steigert langfristig durch einen stringenten Einsatz den monetären Markenwert. Eine erfolgreiche Audiologo-Entwicklung geht daher zu erst mit einer intensiven Auseinandersetzung mit der Marke und seinen Marktbegleitern sowie der Zielgruppe einher.
Damit die akustische Marke schnell gelernt werden kann, bzw. die richtigen Assoziationen auslöst, sollte ein präziser Wissensstand der Rezipienten vorliegen. Je schneller und intuitiver ein akustisches Signal einer bestimmten Produktkategorie, einer bestimmten Produktaussage oder einem emotionalen Ausdruck zugeordnet wird, desto schneller wird das akustische Zeichen zu einem hörbaren Markenzeichen. Darüber hinaus sollte die ausführende Agentur methodisch in der Lage sein allgemeine Markenwerte wie zum Beispiel "Innovation" oder "Qualität" in akustische bzw. multimodale Parameter zu übersetzen.
Wie gehen Konsumenten mit Veränderungen des Audiologos um? Ist das vergleichbar mit einem Verpackungs-Relaunch?
Es gibt einige gute Beispiele, wie ein akustisches Redesign funktionieren kann, wie zum Beispiel das Audiologo der Sparkasse. Zu Beginn wurde es als Jingle, also gesungener Claim, etabliert. Wie das visuelle Corporate Design wurde das akustische Zeichen in regelmäßigen Abständen modifiziert. Es wurde beispielsweise in den letzten Jahren nur noch rein melodiös ohne Stimme als Audiologo eingesetzt. Dem Konsumenten fallen diese leichten Veränderungen nicht auf, setzen jedoch auf das wertvolle, über Jahre gelernte auditiven Markenwissen auf.
Welche Rolle spielen akustische Reize von Marken am POS?
Akustische Reize beeinflussen physiologische als auch unterbewusste Handlungsentscheidungen. So hat beispielsweise das Tempo einen Einfluss darauf, wie schnell sich Konsumenten im Raum bewegen. Wir haben etwa bei einem Raumklang-Projekt für einen internationalen Leuchtenhersteller beobachten können, dass sich Besucher des Showrooms signifikant langsamer durch den Raum bewegten als ohne das atmosphärische Soundscape. Das führte zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit den Showroom-Objekten und zu einer erhöhten Produktnachfrage.
Des Weiteren gibt es Untersuchungen über den Einfluss auf Kaufentscheidungen. Der Musikpsychologe Adrian North hat so unter anderem für den Weinhandel herausgefunden, dass sich unentschlossene Konsumenten von der Hintergrundbeschallung beeinflussen lassen. Klischeehafte französische Hintergrundmusik führt so zu einer Absatzsteigerung französischer Weine.
Der digitale Auftritt im Netz wie auch in sozialen Netzwerken spielt für Unternehmen eine immer größere Rolle. Wie wichtig ist es für Marken mit bekannten Audiologos, diese auch auf diesen Kanälen zu spielen?
Einerseits ist sehr wichtig, da hierbei das Audiologo als emotionaler Absender ideal zum Einsatz kommen kann. Andererseits kann dies auch etwas gefährlich für eine Marke werden, wenn dies ohne technische Strategie geschieht. Man kann mit akustischen Reizen schnell Stress und Unbehagen auslösen. Hier unterscheiden wir nach aktiver und passiver Akustik. Die aktive Akustik wird vom Nutzer selbst ausgelöst und bringt so die entsprechende Erwartungshaltung mit. Dazu gehören zum Beispiel Podcasts, Filme oder Funktionsklänge wie ein Button-Klicken. Unerwartete Klänge überraschen den Nutzer, brechen seine Erwartungshaltung und können schnell zur Ablehnung führen. Automatische Hintergrundmusik oder Hinweistöne, wie sie unter anderem bei verschiedenen Chat-Funktionen auftreten, ist als passive Akustik zu bezeichnen.
Zahlreiche Studien erheben die "wertvollsten Marken". Gibt es Vergleichbares für den akustischen Teil einer Marke?
Ein Ranking dieser Art gibt es bisher noch nicht. Man kann auch feststellen, dass es bis dato sehr wenig Forschung zum monetären Wert akustischer Markenelemente gibt. Eine Pionierarbeit auf diesem Gebiet stammt aus dem Jahr 2009 von Philipp Müller der ESB Business School der Hochschule Reutlingen. Sie untersuchte erstmals den Stand zur sogenannten Audio-Brand-Equity und stellt eine gute Übersicht über Bewertungsmethoden dar.
Derzeit arbeiten wir mit universitärer Unterstützung an diesem Thema. Wir gehen davon aus, dass wir Laufe des kommenden Jahres einen ersten Zwischenstand präsentieren können.